MINT-Tage: Schulklassen erproben Wissensmedien für das Lernen von morgen
12.08.2025: Während der mit der Geschwister-Scholl-Realschule Nürtingen organisierten MINT-Tage besuchten jeweils im Frühjahr 2024 und 2025 Schülerinnen und Schüler den Future Innovation Space (FIS) am Leibniz-Institut für Wissensmedien (IWM), die naturwissenschaftlichen Lernlabore der Universität Tübingen sowie den KI Makerspace in Tübingen. Ihr Lehrer, Nils Spitlbauer, gibt im Interview Einblicke in seine Einschätzungen zu den Zukunftstechnologien, die dabei erprobt wurden.

Im Future Innovation Space (FIS) am IWM wird zum Potenzial von Künstlicher Intelligenz (KI), von Virtual und Augmented Reality (VR /AR) oder auch von kollaborativen Medien wie Multi-Touch-Tischen geforscht. Während der gemeinsam mit der Universität Tübingen organisierten MINT-Tage 2024 und 2025 konnten Fünft- und Siebtklässler/innen der Geschwister-Scholl-Realschule Nürtingen diese Technologien näher kennenlernen. Sie erprobten die Wirkung von Prompts, um ein Escape-Rätsel zu lösen, arbeiteten am Multi-Touch-Tisch zu Insekten, deren Fotos sie dort sehr stark vergrößerten und gemeinsam sortierten und sie schlüpften mithilfe einer VR-Brille in eine Wespe, die nur wenige Millimeter groß ist.
Die Schülerinnen und Schüler setzten sich auch kritisch mit diesen digitalen Lernmöglichkeiten auseinander und unterschieden zwischen der anfänglichen Begeisterung über die neuen Perspektiven und dem tatsächlichen Einfluss, den zum Beispiel die Arbeit mit VR-Brillen auf ihren Wissenserwerb haben könnte. Interessant fanden sie die neuen Einblicke, die die VR-Brille ermöglicht. Es wurde aber auch angemerkt, dass in der VR-Anwendung, mit der sie gearbeitet haben, ein erklärender Text fehlte, um wirklich zu lernen, wie die Wespe, die betrachtet wurde, aufgebaut ist. Die jüngeren Schülerinnen und Schüler wünschten sich teilweise auch, von der Lehrkraft in der virtuellen Realität begleitet zu werden, so dass Ihnen das, was sie sehen und erleben, gleichzeitig genauer erklärt wird.
Als verantwortliche Lehrkraft gestaltete Nils Spitlbauer, der an der Geschwister-Scholl-Realschule in Nürtingen die Fächer BNT [Fächerverbund Biologie, Naturphänomene, Technik], Erdkunde und Technik unterrichtet, die MINT-Tage in Tübingen. Er erklärt im folgenden Interview, was die dabei am FIS erprobten Technologien mit dem aktuellen Medieneinsatz an seiner Schule zu tun haben und welche Inspirationen er aus dem Besuch für den Schulalltag mitnimmt.
Interview

Herr Spitlbauer, wann nutzen Sie digitale Tools aktuell in Ihrem Unterricht?
Das ist ganz vom Thema abhängig, das in der jeweiligen Unterrichtsstunde behandelt wird. Es gibt Themen, die durch Texte oder auch durch zusätzlich analog zur Verfügung gestellte Bilder sehr gut erarbeitet werden können − wie zum Beispiel das Zeichnen und Auswerten eines Klimadiagramms. Es gibt aber auch Themenbereiche, bei denen sich durch Videos oder Lern-Apps ein wesentlich höherer Lernerfolg einstellt, weil sie komplexer sind und der Bedarf an differenzierten Lernangeboten größer ist. Manche Schülerinnen und Schüler lernen zum Beispiel gut mit einer Kombination aus Lern-App und Lehrbuch. Für einige sind auch Lernvideos sehr hilfreich. Deshalb habe ich auch schon selbst Lernvideos erstellt und auf YouTube hochgeladen, wenn ich zu dem betreffenden Themenbereich nichts Passendes gefunden habe.
Haben Sie den Eindruck, dass es bestimmte Schülergruppen gibt, die mehr vom Einsatz digitaler Medien profitieren können als andere?
Aktuell heißt „digitale Medien“ bei uns vor allem, dass wir den Klassensatz Tablets, der an unserer Schule zur Verfügung steht, einsetzen oder mit dem Beamer etwas zeigen. Und was den Einsatz der Tablets betrifft, ist mein Eindruck, dass eher die Kinder davon profitieren, die ein großes Interesse für meine Fächer mitbringen und auch ein bisschen Vorwissen haben, wie sie mit diesem Tool gut umgehen und damit lernen können. Aber teilweise ist es auch so, dass Schülerinnen und Schüler, die inhaltlich nicht so motiviert sind, die Arbeit mit den Tablets als etwas Besonderes empfinden und dadurch engagierter mitarbeiten als in anderen Unterrichtstunden. Ich sehe da also durchaus zwei unterschiedliche Chancen, die der Tablet-Einsatz im Unterricht bietet: Man kann hier die einen motivierter abholen und die anderen besser fördern, weil sie, wenn sie mit den Tablets sehr gut klarkommen, einen noch tieferen Einblick ins Thema erhalten, als wenn nur mit dem klassischen Schulbuch gearbeitet wird.
Wie könnte man Ihrer Einschätzung nach gerade Schülerinnen und Schülern, die bestimmte Schwierigkeiten haben, mit einer besseren Ausstattung mit digitalen Medien an der Schule helfen?
Da sehe ich unterschiedliche Möglichkeiten. Ab dem 7. Schuljahr gibt es im Unterricht bei uns eine Differenzierung nach unterschiedlichen Niveaus. Die Schülerinnen und Schüler im G-Niveau [grundlegendes Niveau] erhalten teilweise vereinfachte Arbeitsblätter, Tippkärtchen oder mehr Unterstützung in der Arbeitsphase. Wenn man das digital umsetzt, stehen andere Möglichkeiten zur Verfügung. Zum Beispiel kann ein Tippgeber spielerischer im BNT-Unterricht auftreten als eine bestimmte Person, etwa als ein Professor, der immer wieder Tipps durch Anklicken einer Sprechblase gibt. So könnte ein Lerndialog das Arbeiten begleiten und durch Kontrollaufgaben digital eine Lernstandsdiagnose durchgeführt werden. Ich denke, dass es für die Kinder mit unterschiedlichen Lernausgangslagen sehr effektiv sein könnte, wenn wir solche tutoriellen Systeme einsetzen könnten. Aber auch kleinschrittige Aufgaben in Kombination mit kleinen Erfolgsmomenten durch Überprüfen der Lösungen am Tablet, beispielsweise durch eine Quizaufgabe oder eine Zuordnungsaufgabe, sind eine Möglichkeit, schwächere Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Das motiviert die Kinder am Ball zu bleiben und weiterzuarbeiten.
Welche Technologien, die Sie am IWM kennengelernt haben, finden Sie für den MINT-Unterricht besonders interessant oder inspirierend?
Sehr effektiv erschien mir die Arbeit am Multi-Touch-Tisch, der auch viele spielerische Zugänge ermöglicht. Ich würde mir wünschen, an meiner Schule einen Multi-Touch-Tisch zur Verfügung zu haben und gerne regelmäßig damit arbeiten – zum Beispiel im Biologieunterricht, wo ja Detailaufnahmen eine entscheidende Rolle spielen. In der Gruppenarbeit könnten dann ganz unterschiedliche Struktur- und Zuordnungsaufgaben gelöst werden. Das wäre im Klassenzimmer fantastisch, gerade im Hinblick auf individuelles oder selbstorganisiertes Lernen sowie Lernen in Gruppen: Die Kinder können kreativ werden und selbst entdeckend vorgehen. Auch in Geografie lässt sich an einem solchen Tisch ganz intuitiv Kartenarbeit machen, für die man sonst ja von Hand gezeichnet hat. So können Gruppen auf dem Multi-Touch-Tisch Karten farblich markieren oder Kartenbereiche herausarbeiten. Wir können aber auch mit Karten gemeinsam arbeiten, um etwas zu verorten, Dinge auf Weltkarten suchen, Schaubilder oder Höhenliniendiagramme zeichnen – es gibt so viele Möglichkeiten auch für den Geografieunterricht. Im Technikbereich könnten Getriebe und Zahnräder zu einem Anschauungsmodell zusammengebaut werden. Ich sehe sehr viele Anwendungsmöglichkeiten.
Auch die Arbeit mit VR-Brillen hat meiner Einschätzung nach großes Potenzial – vor allem in Bezug auf Simulationen. Ich denke da beispielsweise im Fach Technik an das Durchspielen von Arbeitsabläufen eines technischen Berufs. Um solche VR-Anwendungen in die Schule zu holen, müsste man allerdings auf vorhandene Angebote zurückgreifen. Und da gibt es auch für unterschiedliche Bereiche Anwendungen, die im Unterricht mit großem Potenzial genutzt werden können − beispielsweise Anatomie-Apps zum Betrachten des menschlichen Körpers und zum Auseinanderbauen der Knochen eines Skeletts oder virtuelle Museumsrundgänge.
Für unseren Ausflug zum Future Innovation Space haben wir ja auch die Arbeitsblätter mit ChatGPT erstellt, um den Nutzenfaktor zu überprüfen und vor allem auch zu überprüfen, ob die Kinder mit den Formulierungen klarkommen, die ChatGPT altersgemäß auf Grundlage des Prompts für eine fünfte oder eine siebte Klasse ausgibt. Die Schülerinnen und Schüler haben die Fragen an sich verstanden, es war ihnen klar, was sie machen müssen. Ein großer Unterschied zu „selbstgebastelten“ Formulierungen besteht allerdings darin, dass die Begriffe und der Satzbau komplizierter waren, als wenn sie ein Lehrer schreibt, also eher verschachtelte Sätze als kürzere Angaben. Da hat die Lehrkraft einfach den Vorteil, dass sie weiß, wie die Kinder ticken, dass sie weiß, wie sie es verstehen. Auch weiß die Lehrkraft, wie kleinschrittig sie die Aufgaben je nach Lerngruppe formulieren muss. ChatGPT versucht außerdem Fachbegriffe in die Aufgaben hineinzuformulieren, die dann zwar in Klammern stehen, die aber die Kinder nicht verstehen. Das ist dann doch fachlich ein bisschen zu hoch. Generative KI hat für die Aufgabenerstellung sicherlich großes Potenzial, da die Ausgabe auch immer von der Eingabe (Prompts) abhängig ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass durch detailliertere Beschreibungen der Schüler/innengruppe und der Vorhaben auch differenziertere Ergebnisse erzielt werden.
Auch wenn Sie an Ihrer Schule aktuell noch nicht mit Multi-Touch-Tischen und VR-Brillen arbeiten können – brachte Ihnen der Besuch im FIS auch Inspiration für Ihren alltäglichen Unterricht?
Letztlich haben wir hier an der Schule einen Multi-Touch-Tisch im Kleinformat: das Tablet. Und ich denke, dass es auch hiermit realisierbar wäre – eben im kleineren Format – mehr in Gruppen zu arbeiten. Ich nehme mir vor, wesentlich mehr damit zu arbeiten mit den Inspirationen, die ich vom Multi-Touch-Tisch mitgenommen habe. Unabhängig von den digitalen Medien nehme ich mir aber vor allem vor, mehr praktisches und entdeckendes Arbeiten in den einzelnen Unterrichtsstunden zu ermöglichen, damit man nicht in den Trott hineinkommt, den wahrscheinlich viele Lehrkräfte kennen: Man hat eine Problemstellung oder eine Anfangsfrage. Die Schülerinnen und Schüler überlegen sich Hypothesen dazu. Es gibt ein Arbeitsblatt, das sie mit einem Buch bearbeiten sollen. Dann bespricht man das. Die Hypothesen werden kontrolliert und dann ist die Stunde zu Ende. In der letzten Zeit hat sich an unserer Schule allerdings didaktisch viel getan. Und wir planen, in die Ausstattung mit digitalen Medien zu investieren. Denn das Potenzial digitaler Medien ist wirklich groß. In Bezug auf das heterogene Klassenzimmer bieten sie auch die Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler durch verschiedene Kanäle Wissen aufnehmen können. Und der „Wow“-Effekt in der Nutzung digitaler Medien motiviert die Schülerinnen und Schüler enorm. Wenn dieser Motivationsschub, gepaart mit sinnvoller Didaktik dazu beiträgt, dass Schülerinnen und Schüler engagierter lernen, haben wir bereits viel erreicht.
Dann wünschen wir Ihnen für die Zukunft viel Erfolg und bedanken uns für das Interview!
Dieses Interview erschien ebenfalls im lernen:digital-Zukunftsraum. Es wurde für die Veröffentlichung auf dem Portal schule-mal-digital.de gekürzt und angepasst.
Über den Interviewpartner
Nils Spitlbauer ist seit 2021 Lehrer an der Geschwister-Scholl-Realschule in Nürtingen und unterrichtet die Fächer Erdkunde, BNT [Fächerverbund Biologie, Naturphänomene, Technik] und Technik. Als Leiter des MINT-Bereichs an der Schule ist er für die Umsetzung des MINT-Profils zuständig. Durch seine persönlichen Erfahrungen mit Lernschwierigkeiten in der Schule ist es ihm ein besonderes Anliegen, Kinder mit Motivationsproblemen und Lernschwierigkeiten zu fördern.
Über den Future Innovation Space am IWM
Der Future Innovation Space am IWM ist sowohl ein Living Lab für die Forschung als auch ein Erlebnisort für (angehende) Lehrkräfte, an dem sie mit neuen Technologien experimentieren und sich mit Forschenden austauschen können. Er ist im Jahr 2023 im Rahmen der Beteiligung des IWM am bundesweiten und interdisziplinären Kompetenzverbund lernen:digital ins Leben gerufen worden und wurde am 10. November 2023 offiziell eröffnet.
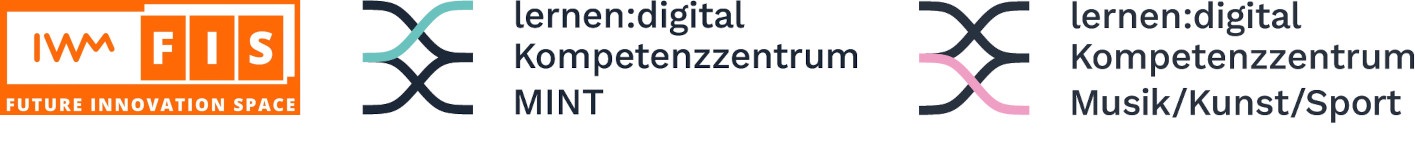
 Sofern nichts anderes angegeben wurde, stehen die
Inhalte dieser Seite unter der Lizenz
Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International.
Verlinkte Inhalte sind von der Lizenz unberührt.
Unter Beachtung der Lizenzbedingungen ist es gestattet,
die Inhalte der Seite zu vervielfältigen, zu verbreiten und
öffentlich zugänglich zu machen, sofern dabei
die beteiligten Autorinnen und Autoren (hier:
Nils Spitlbauer)
und schule-mal-digital.de genannt werden und die Verarbeitung und Weitergabe an Dritte wiederum zu diesen Bedingungen erfolgt.
Sofern nichts anderes angegeben wurde, stehen die
Inhalte dieser Seite unter der Lizenz
Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International.
Verlinkte Inhalte sind von der Lizenz unberührt.
Unter Beachtung der Lizenzbedingungen ist es gestattet,
die Inhalte der Seite zu vervielfältigen, zu verbreiten und
öffentlich zugänglich zu machen, sofern dabei
die beteiligten Autorinnen und Autoren (hier:
Nils Spitlbauer)
und schule-mal-digital.de genannt werden und die Verarbeitung und Weitergabe an Dritte wiederum zu diesen Bedingungen erfolgt.
